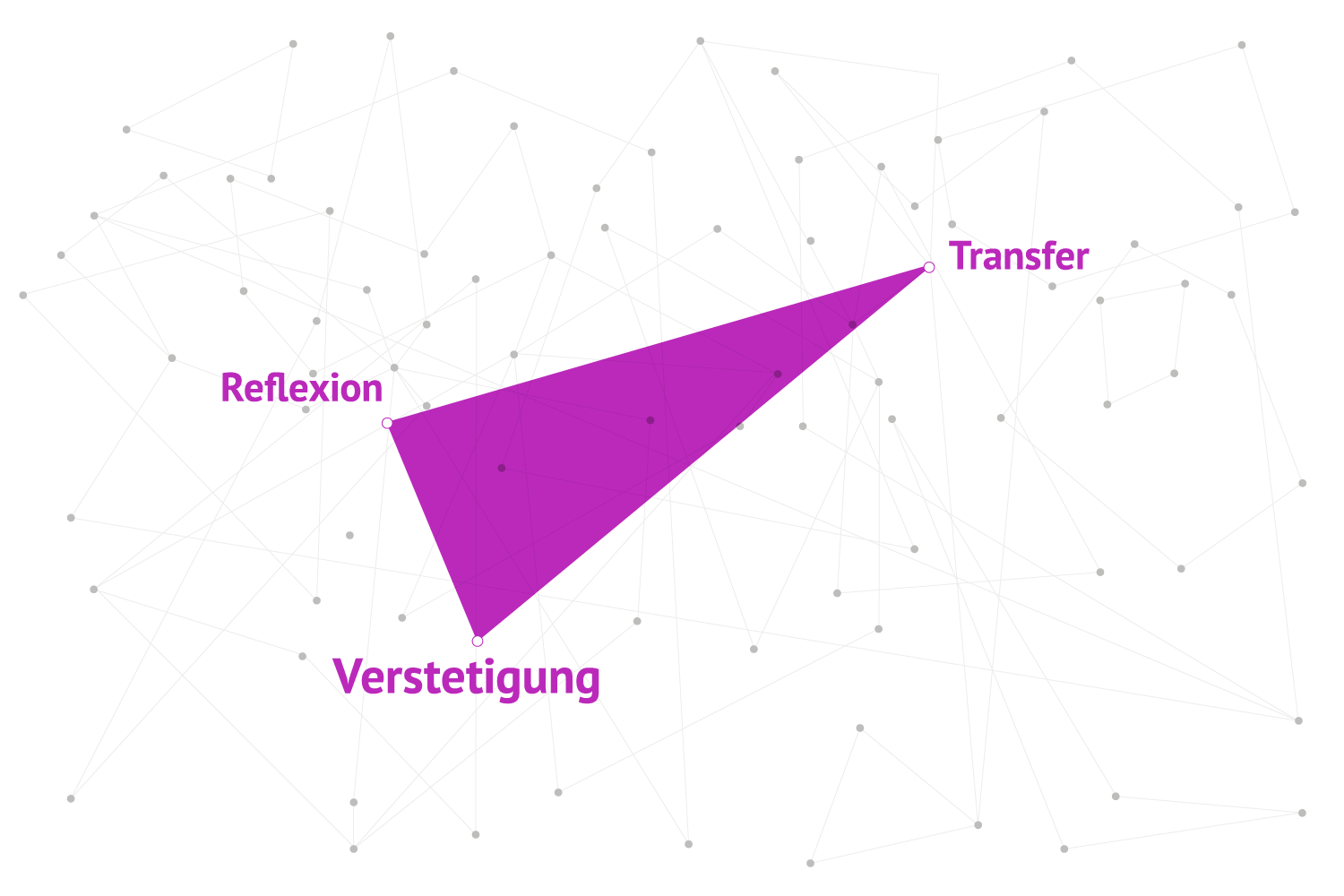
… und wie implementieren wir das?
Der Titel meiner Überlegungen zur nachhaltigen Verankerung des Modellprogramms "Kulturagenten für kreative Schulen" suggeriert möglicherweise eine spezifisch österreichische Zugangsweise, die sich durch einen etwas höheren Grad an Unbestimmtheit und Informalität als im deutschen Sprachgebrauch auszeichnet. Dies bezieht sich insbesondere auf das "Das", das da implementiert werden soll und von dem ich mir vorstellen kann, dass die Leserinnen und Leser damit unterschiedliche Erwartungen verbinden werden. Immerhin gehe ich nicht davon aus, dass Ihre Interpretation darauf hinausläuft, das laufende Programm, so wie es jetzt durchgeführt wird, eins zu eins auf alle deutschen Schulen auszuweiten, auch wenn das wünschenswert wäre.
Ich möchte mit diesem Beitrag Lust auf gemeinsame Überlegungen über die besondere Qualität des Programms machen. Die Ergebnisse sind eine Voraussetzung für die Entwicklung von Strategien, wie seine Besonderheit über das offizielle Ende hinaus gerettet und für neue Akteursgruppen interessant gemacht werden kann.
Auf der Suche nach den Zielen des Programms "Kulturagenten für kreative Schulen" habe ich auf der Webseite folgende Formulierung gefunden: Es "möchte bei Kindern und Jugendlichen Neugier für die Kunst wecken und mehr Kenntnisse über Kunst und Kultur vermitteln, um eine Bildung und Stärkung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen und ihnen die Chance zu eröffnen, künftige Akteure einer kulturinteressierten Öffentlichkeit werden zu können."1
Wir müssen das Rad nicht neu erfinden
Ich hoffe, ich frustriere nicht allzu sehr, wenn ich dieser Absichtserklärung ein anderes Zitat gegenüber stelle, das über 100 Jahre alt ist. Es stammt von der legendären österreichischen Schulreformerin Eugenie Schwarzwald, die in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts frühe Kulturagenten in Person von Arnold Schönberg und Oskar Kokoschka in ihre private Schule eingeladen hat, um ihrem Anspruch einer "mit Kunst durchfluteten Schule" gerecht zu werden. Als Gründe dafür nennt sie: "Die Aufgabe der Schule ist es – ihre schönste Aufgabe vielleicht –, die Bekanntschaft mit den Künsten zu vermitteln und dadurch um die Menschheit ein gemeinsames Band zu knüpfen."2
Aus dieser Gegenüberstellung ergeben sich für mich zweierlei Erkenntnisse: Erstens lässt sich damit das angesprochene "Das" näher bestimmen, das – wenn auch noch sehr allgemein – einen Auftrag von Schule umschreibt, eine positive Beziehung junger Menschen zu Kunst zu entwickeln. Zweitens wird deutlich, dass wir es nicht mit einem neuen Ziel zu tun haben. Vielmehr stehen wir einer langjährigen Tradition gegenüber, die die Überzeugung, die Beschäftigung mit Kunst in der Schule (und darüber hinaus) habe positive Wirkungen auf Kinder und Jugendliche, anhand einer gelebten Praxis aufrechtzuerhalten versucht. Ich jedenfalls lerne daraus, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen, sondern uns einreihen (können) in eine lange Geschichte von Bemühungen, der Beschäftigung mit Kunst und Kultur im Rahmen von Bildungsprozessen den Raum zu geben, den sie verdienen.
Aber warum müssen wir auf eine so lange Vergangenheit zurückblicken und haben doch noch immer nicht den Eindruck, dass die Beschäftigung mit Kunst und Kultur hinlänglich implementiert worden ist? Einer der Gründe mag darin liegen, dass es ganz offensichtlich wirkmächtige Kräfte innerhalb (und vielleicht auch außerhalb) des Schulsystems gibt, die gegenteilige Vorstellungen vertreten und meinen, Kunst hätte in der Schule nichts verloren. Wenn das so ist, dann empfehle ich, diese Kräfte nicht nur pauschal zu denunzieren (Stichwort "Pisa ist schuld"), sondern ganz konkret zu identifizieren und sich mit ihren Positionen taktisch, vielleicht auch strategisch das Feld insgesamt betreffend, auseinanderzusetzen. Dabei können wir durchaus "von der Geschichte lernen", weil immer wieder zumindest partielle Erfolge errungen worden sind, auch wenn diese nicht auf Dauer sichergestellt werden konnten.
Implementieren heißt, sich in einen Interessenkonflikt zu begeben
So komme ich zum ersten Schluss, der darin besteht, dass das, was damalige wie heutige Kulturagentinnen und Kulturagenten umtreibt, Ausdruck spezifischer Interessen ist, die sich in einer Arena konfligierender Interessen zu behaupten haben. Deborah Holmes lässt uns in ihrer Biografie von Eugenie Schwarzwald, "Langeweile ist Gift"3, eindrucksvoll nachvollziehen, was diese alles unternommen hat, um ihre Projekte zu realisieren und Unterstützung dafür zu gewinnen. Nur zu oft sah sich Schwarzwald neben der Anerkennung (aber nicht Förderung) durch die Wiener Schulverwaltung der Zwischenkriegszeit mit schmerzlichen Niederlagen konfrontiert, bis ihr Lebenswerk schließlich von den Nazis zerstört wurde.
Ihr Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass "wir" nicht per se auf der richtigen Seite stehen (und alle anderen Ignoranten sind, die unseren Anspruch nicht erkennen und unterstützen), sondern – in einer pluralistischen Gesellschaft ganz besonders – dass wir als politische Subjekte um die Realisierung unserer Vorstellungen werben, da und dort auch kämpfen müssen. Entsprechend erscheint mir eine überzeugende Haltung gepaart mit entsprechendem Durchsetzungswillen (inklusive eines langen Atems) eine Grundvoraussetzung jeglicher Implementierungsversuche.
Die Weigerung vieler Akteure, sich in die Niederungen der Interessenkonflikte zu begeben, mag einer der Gründe für die tendenzielle Randständigkeit von Kunst in der Schule sein, die diesbezügliche Aktivitäten im Verlauf des 20. Jahrhunderts charakterisiert haben. Ein anderer mag darin liegen – und hier komme ich auf das "Das" zu Beginn meiner Überlegungen zurück –, dass wir nicht präzise genug sagen können, vielleicht auch gar nicht sagen wollen, um was es geht, und uns so die Mühe ersparen, hinlänglich genaue Aussagen zur handlungsleitenden Bestimmung zu treffen, was konkret implementiert werden soll.
Über den Entscheidungsbedarf in Spannungsfeldern
Meine Institution EDUCULT hat sich vor Kurzem eine Reihe von sogenannten Modellprojekten kultureller Bildung4 in einigen deutschen Bundesländern genauer angesehen und ist dabei auf Spannungsfelder gestoßen, die das Feld charakterisieren und uns zwingen, vorab zumindest zu entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Da ist zum einen das Spannungsverhältnis zwischen einem innovativen und einem strukturbildenden Anspruch. Während der erste darauf aus ist, etwas Neues in die Welt zu setzen, möchte der zweite Zuständigkeiten, Regeln und Verfahren festlegen, die eine überpersonelle, institutionelle Verbindlichkeit schaffen und auf diese Weise Sicherheit für einen kontinuierlichen Betrieb ermöglichen. Entsprechend müssen wir entscheiden, ob wir auf innovative Weise bestehende Strukturen infrage stellen, vielleicht sogar überwinden oder uns um eine Befestigung und Vertiefung dieser bemühen wollen; beides zu verfolgen, ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Eine diesbezügliche Entscheidung scheint aktuell vor allem deshalb von besonderer Bedeutung, weil gerade in Zeiten der Krise traditionelle Strukturen zunehmend defensiven Charakter annehmen und sich neue Entwicklungen in informellen, oft nur kurzlebigen Netzwerken aus schillernden Allianzen abspielen. Diese Entwicklung stellt ein bisheriges Selbstverständnis infrage, wonach sich eine kultur- beziehungsweise bildungspolitische Absicht erst dann als erfolgreich erweise, wenn sie in institutionelle Strukturen gegossen werden kann. In dem Maß, in dem heute niemand mehr sagen kann, wie bislang sakrosankt erscheinende Institutionen auch nur in wenigen Jahren aussehen werden, spricht vieles für den Ausbau flexibler, den jeweiligen Umständen anpassbarer Organisationsformen ohne großen organisatorischen Aufwand.
Auch die Frage, ob wir mit unseren Aktivitäten eine Verbreiterung unserer Zielgruppen erreichen oder mit bestehenden eine Vertiefung der Auseinandersetzung mit Kunst erreichen wollen, sollte geklärt werden. Immerhin liegt es auf der Hand, dass wir uns je nach Entscheidung unterschiedlicher Zugangsweisen bedienen müssen. Geht es uns bei unseren Vorhaben um die Erreichung klar definierter Ziele? Oder sollen möglichst offene Experimentierräume geschaffen werden, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Mitwirkung an ergebnisoffenen Prozessen ermöglicht? Erwarten wir nachweisbare Belege der Zielerreichung oder sehen wir gerade im Scheitern besondere Lernpotenziale?
Als eine Grundsatzfrage erweist sich immer wieder auch das Verhältnis zu den unmittelbar Involvierten: Haben wir genügend Vertrauen in die handelnden Personen; nehmen wir ihre Erfahrungen und damit verbundene Expertise ernst, setzen auf Partizipation und beziehen wir sie mit ein in allgemeine Implementierungsüberlegungen? Oder aber setzen wir auf Kontrolle von oben, wollen wir den Verlauf des Projekts "im Griff haben", um jederzeit steuernd eingreifen zu können? Der immer wiederkehrende Ruf nach einem handlungsleitenden "Gesamtkonzept" deutet darauf hin, dass selbst in ansonsten sehr partizipativ agierenden Kreisen das "Top-down-Prinzip" nicht völlig ad acta gelegt worden ist. Nicht unwichtig ist auch die Vorab-Entscheidung, ob und wenn ja in welcher Weise wir uns mit dem jeweiligen Vorhaben profilieren wollen oder bereit sind, mit anderen zu kooperieren. Im ersteren Fall können wir die Ziele und ihre Realisierung weitgehend selbst entscheiden, während es im Fall einer Kooperation darauf ankommt, die spezifischen Zugangsweisen der Partner in die eigenen Überlegungen einfließen zu lassen und zugunsten einer erhöhten Wirksamkeit zu lebbaren Kompromissen zu gelangen.
Über das Neue und über die Notwendigkeit der Zerstörung des Alten
Bereits 1992 – kurz nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes – schrieb der Philosoph und Kunstkritiker Boris Groys in seinem Band "Über das Neue", dass wir in eine Phase der sozialen und künstlerischen Praxis eintreten würden, die nicht mehr dem Diktat des Neuen gehorche/unterliege: "Unsere Zeit hat die Problematik des Neuen beinahe endgültig überwunden."5 Diese in erster Linie geschichtsphilosophische Aussage finde – laut Groys – ihre Entsprechung in einer zunehmenden inhaltlichen Entleerung des Begriffs der "Innovation". Zwar transportiere er die Sehnsucht nach Veränderung und Entwicklung, könne aber immer weniger genau beschreiben, was wie ganz konkret verändert oder entwickelt werden soll. In diesem Zusammenhang lohnt ein Hinweis auf den österreichischen Nationalökonomen Joseph Schumpeter, der in seinen ökonomischen Überlegungen zu dem Schluss gekommen ist, dass Neues in den seltensten Fällen zu Bestehendem hinzugefügt werden kann. Stattdessen spricht er von "schöpferischer Zerstörung", die notwendig wäre, um Veränderungen wirksam werden zu lassen. Das aber – und hier komme ich auf meine erste Schlussfolgerung zurück – setzt voraus, der Zerstörung des überkommenen Alten die zumindest gleiche Aufmerksamkeit zu schenken wie der Realisierung des erwünschten Neuen (so es denn wirklich neu ist).
Ich erwähne diese Notwendigkeit auch, weil ich allerorten eine zunehmende Ermüdung des Schulsystems wahrnehme, das sich unterschiedlichen, zum Teil konfligierenden Veränderungsansprüchen gegenübersieht. Zu kurz kommt dabei eine besondere Qualität von Schule, die darin besteht, sich als veränderungsresistent zu erweisen und damit oft (letzte) Orte der Sicherheit in einer Welt anbietet, während allerorten bewährte Sicherheiten zusammenbrechen. Die Schule kann eine Instanz sein, Schülerinnen und Schülern Halt zu bieten, wenn sie keinen anderen Ort mehr finden. Hier gilt es, sich in die Situation der schulischen Akteure hineinzuversetzen und klug abzuwägen, was an konkreter Veränderung am jeweiligen Standort zumutbar erscheint (und zumindest in the long run als bereichernd erlebt werden kann) und was als Ausdruck arroganter Zurufe von außen als weitere Zumutung wahrgenommen wird.
Reflexion
Gegen Ende des Programms "Kulturagenten für kreative Schulen" beschäftigen sich die Akteure mit den Dimensionen Reflexion, Verstetigung und Transfer, zu denen ich im Folgenden einige Stichworte liefern möchte: Die Institution EDUCULT, die ich seit 13 Jahren leite, trägt den Untertitel "Denken und Handeln im Kulturbereich". Mit dieser Konjunktion wollten wir bewusst einer Dichotomie entgegenwirken. Diese beruht einerseits auf der Unterstellung, Schule orientiere sich zu sehr an der kognitiven Wissensvermittlung (als Voraussetzung für Denken) und dem Versprechen, kulturelle Bildung wäre in besonderer Weise in der Lage, die dadurch entstandenen affektiven und emotionalen Defizite durch konkretes Handeln zu kompensieren. Wer die gegenwärtige Schullandschaft genauer beobachtet, findet rasch heraus, dass sich die Schuldidaktik in (fast) allen Fachbezügen (durchaus unterschiedlich an unterschiedlichen Schulstandorten) von einer stärkeren Handlungsorientierung leiten lässt. Praktisches Tun ist kein Privileg kultureller Bildung mehr. Umgekehrt erschöpft sich der Sektor kultureller Bildung immer weniger in einem blinden Aktionismus des "ganz Anderen", sondern bemüht sich um eine Festigung seiner konzeptionellen Grundlagen. Das Modellprogramm ist das beste Beispiel dafür.
Das bringt mich zu der Vermutung, dass eine Rebalancierung von Denken und Handeln angesagt ist und wir alle gefordert sind, dafür gute Voraussetzungen zu schaffen. Die Gründe liegen auf der Hand: Da ist zum einen ein fast unerschöpflicher Fundus an Erfahrungen aus den letzten 100 Jahren, die es so aufzuarbeiten gilt, dass wir aus den Erfolgen und Fehlschlägen lernen können. Gerade weil wir in der gegenwärtigen Situation mit einer besonderen Form der Amnesie geschlagen zu sein scheinen, die meint, sich mit dem begnügen zu können, was "jetzt" gerade passiert, plädiere ich dafür, Erkenntnisse aus der Geschichte als Ressource stärker als bisher zu nutzen und darüber nachzudenken, was warum gut oder auch schlecht gelaufen ist.
Zum anderen ist die Reflexion des eigenen Vorhabens Voraussetzung dafür, zu erkennen, dass ich nicht im luftleeren Raum agiere und ich stattdessen den Kontext einbeziehen muss, in dem ich mich mit meinem Vorhaben bewege. Und so zählen bei der Realisierung Intuition und Erfahrung, aber eben auch das Nachdenken darüber, was ich wie, warum und unter welchen Umständen tue. Eines der Ergebnisse könnte sein, dass es keinen Generalschlüssel für Implementierung dessen gibt, was mir am Herzen liegt, sondern dass die je konkreten Umstände, die ich erfahre, erkenne und analysiere, eine Grundvoraussetzung für jegliche konzeptionellen Überlegungen zur Implementierung dieses oder jedes Vorhabens sind.
Diese Form des Denkens umfasst auch die bestmögliche Berücksichtigung von Partnern, Unterstützern, vielleicht auch Gegnern, deren "Sprache" ich verstehen lernen muss, wenn ich sie überzeugen beziehungsweise umstimmen will. Dafür bedarf es "durchdachter" Argumente, ohne diese wir nur auf wenig Gegenliebe stoßen werden.
In dem Maße, in dem ich selbst als Evaluator kultureller Bildungsmaßnahmen tätig bin, stoße ich auf die wachsende Bereitschaft, Projekte nicht nur durchzuführen, sondern deren Durchführung auch zu reflektieren und dafür allenfalls sogar evaluative Hilfe in Anspruch zu nehmen. Natürlich ist da nach wie vor das Argument, die zur Verfügung stehenden Mittel reichten nicht aus, um neben dem Tun auch das Reflektieren zu ermöglichen. Und doch steigt das Wissen, dass ein schierer Aktionismus in der Hoffnung auf "leuchtende Kinderaugen" als Beleg für den Erfolg immer weniger ausreichen, um eine professionelle Vorgangsweise zu begründen und – im Sinne jeglicher Implementierungsabsichten – nach außen begründbar zu machen.
Verstetigung
"Das Programm kann nur nachhaltig sein, wenn es die Schulen und die mit ihnen kooperierenden Kulturinstitutionen ermutigt, gemeinsame kulturelle Angebote zu entwickeln. Dazu sollen die in den Institutionen tätigen Vermittler – Lehrerinnen und Lehrer, Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende – dafür sensibilisiert werden, die Qualität künstlerischer Angebote zu sichern und die dafür erforderlichen Strukturen zu schaffen."6
Es liegt in der Natur auch nur halbwegs erfolgreicher Vorhaben, dass sich deren Akteure wünschen, diese nach Abschluss weiterzuführen oder zu wiederholen. Die Losung "Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist", scheint an den Hoffnungen auf nachhaltige Wirkungen abzuprallen. Und auch der zur Zeit uns alle beherrschenden Marktlogik, wonach Produkte mit ganz wenigen Ausnahmen einem Zyklus unterliegen, in dem immer rascheres "Veralten" Produzenten zwingt, zumindest die äußere Gestalt ihrer Angebote regelmäßig zu verändern, wollen sich die Betreiberinnen und Betreiber kultureller Bildungsprogramme nicht unterordnen.
Auch oder vielleicht gerade weil wir um uns herum eine bislang ungeahnte Dynamik des Kommens und Vergehens erleben, zeigt sich im Feld der kulturellen Bildung auf ganz besondere Weise die mehr als verständliche Sehnsucht nach einer stabilen Struktur, die eine auf Dauer angelegte Realisierung der eigenen Vorstellungen ermöglichen soll. Versiert im Umgang mit unsicheren Verhältnissen ist der Sektor der kulturellen Bildung immer wieder besonderen Gefährdungen seines Status als integraler Bestandteil jeglicher Bildungsbemühungen ausgesetzt. Viele Betreiber beklagen zudem die grassierende "Projektitis", nach der die eigene Existenzberechtigung durch Förderanträge immer wieder neu erkämpft werden muss.
Schon auf Grund der traditionell prekären Verortung kultureller Bildung am Rand des Schulgeschehens sehe ich die Möglichkeiten einer Verstetigung der zentralen Ziele des Kulturagentenprogramms weniger in der Behauptung seines außerordentlichen Charakters als in der Befähigung der involvierten Akteure, sich auf das zu beziehen, was das Schulsystem und die in ihm Tätigen als Ganzes beschäftigt. Systeme haben ja die Eigenschaft, sich gegenüber Anstößen von außen tendenziell defensiv zu verhalten und diese möglichst unbeschadet abzuwehren. Es bedarf schon einer beträchtlichen "kritischen Masse", die es dazu bringt, sich für diesbezügliche Ansprüche zu öffnen und sie zu inkorporieren.
Ich glaube nicht – aber vielleicht liege ich falsch –, dass das Kulturagentenprogramm trotz seiner imponierenden Größenordnungen in der Lage ist, diese kritische Masse zu liefern und so das Schulsystem mit seinen rund 47.000 allgemeinbildenden Schulen in Zugzwang zu bringen. Stattdessen schlage ich vor, die zurzeit anstehenden zentralen Schulentwicklungsfragen zum Ausgangspunkt von Verstetigungsstrategien zu machen. Dies setzte freilich voraus, sich bereits im Vorfeld mit Fragen der Kompetenzentwicklung und Outputorientierung, neuen Lehr- und Lernformen, Individualisierung und Interkulturalität, Durchlässigkeit, Schulautonomie und Ganztagsschule oder Schule als Zentrum neuer Bildungslandschaften in einer Sprache, die in der Schule verstanden wird, auseinanderzusetzen. Ich denke, dass das Programm eine Reihe beeindruckender Ergebnisse vorweisen kann, die es zugunsten einer Verstetigung auf aktuelle Problemlagen von Schulentwicklung zu übertragen gilt.
In Bezug auf die Qualitätsentwicklung bedarf jede Verstetigung einer sorgfältigen Vorbereitung jeglicher Aktivitäten. Dies schließt die gegenseitig wertschätzende Einbeziehung der unterschiedlichen institutionellen Logiken, Sprachregelungen und Zielerwartungen (die im Vergleich von Schulen und Kultureinrichtungen nach wie vor beträchtlich differieren) aller Involvierten mit ein, um künftige gemeinsame Vorhaben zugunsten der jungen Menschen nachhaltig zu begründen.
Hilfreich könnte es auch sein, bereits im Vorfeld von Verstetigungsbemühungen nicht nur die unmittelbaren Ansprechpartnerinnen und -partner, sondern auch (Mit-)Entscheidungsträgerinnen und -träger im jeweiligen Umfeld zu identifizieren, deren Einstellungen in Bezug auf das Vorhaben wesentlich über das Gelingen oder Nichtgelingen entscheiden. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang die zentrale Rolle der Schulleitung im hierarchischen System Schule genannt, die vieles ermöglichen (aber auch verunmöglichen) kann. Auch eine positive Einstellung von Kolleginnen und Kollegen anderer Fachrichtungen kann wesentlich mithelfen, das Standing einschlägiger Bemühungen zugunsten einer stärkeren Einbeziehung von Kunst in möglichst alle Bereiche des schulischen Lebens zu erhöhen. Es gilt zu klären, was man ihnen – etwa in Form der Bereicherung ihrer Tätigkeit – anbieten kann. Nochmals will ich in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass auch die Identifizierung möglicher Skeptiker beziehungsweise Verhinderer und mit ihrer Berücksichtigung die Entwicklung entsprechender Taktiken ihnen gegenüber wesentlich über den Erfolg oder Misserfolg jeglicher Verstetigungsbemühungen entscheidet.
Abschließend gebe ich zu bedenken, dass der Wunsch nach einer Verstetigung der eigenen Vorhaben zwar sehr nachvollziehbar ist, wir aber berücksichtigen müssen, dass wir als Akteure nur als Mittlerinnen und Mittler, eben als Agentinnen und Agenten auftreten. In dem Maß, in dem wir lernen, uns als kulturelle Bildnerinnen und Bildner zu begreifen, geht es nicht (nur) um die Verfolgung der je eigenen Umsetzungsinteressen. Unser Erfolg bemisst sich nicht nur am Fortbestehen des eigenen Projekts, sondern in erster Linie daran, ob wir in jungen Menschen ein Feuer zu entzünden vermögen, das sie ermutigt, sich ein Leben lang mit Kunst zu beschäftigen und diesbezügliche Erfahrungen in ihre Persönlichkeit zu integrieren. Wenn das unsere Bestimmung ist, dann geht es möglicherweise gar nicht um die Verstetigung des Kulturagentenprogramms, sondern um die Verstetigung eines Bildungswillens der jungen Menschen, Kunst als bereichernde Form der Welterfahrung zu begreifen und sich danach zu verhalten.
Transfer
Es gibt mittlerweile eine Reihe zum Teil hochelaborierter Transferkonzepte.7 Sie alle eint die Absicht, Wissen und Erfahrungen aus einzelnen Projekten so aufzubereiten und zu verallgemeinern, dass sie für die Nichtteilnehmenden produktiv gemacht werden können. Die Idee ist nicht in erster Linie, das jeweilige Vorhaben in möglichst gleicher Weise auch anderweitig zu realisieren, sondern die daraus gezogenen Erkenntnisse über den unmittelbaren Kreis der Akteure hinaus anwendbar zu machen.
Voraussetzung für einen gelingenden Transfer scheint mir zu sein, vorab zu klären, welche (verallgemeinerbare) Lehren sich aus dem bisherigen Verlauf des Kulturagentenprogramms ziehen und wie sich diese in eine gelingende Transferstrategie integrieren lassen. Um an den Anfang zurückzukehren: Es geht um das "Das": Was soll eigentlich transferiert werden? Geht es um die Vermittlung der generellen Ausrichtung, geht es um aus der Realisierung resultierende Ideen, Settings oder geht es um konkrete Handlungsanleitungen? Und wenn das geklärt ist, wem soll dieses "Das" übermittelt werden: Vertreterinnen und Vertretern von Politik oder Verwaltung, (interessierbaren) Lehrenden und Kunstschaffenden, einer neuen Generation von Kulturagentinnen und Kulturagenten oder aber Schülerinnen und Schülern? Immerhin hängt die Aufbereitung der Botschaften, die vermittelt werden sollen, wesentlich von den Adressatinnen und Adressaten und deren jeweiligen Kontexten ab, an die ich mich wende.
In diesem Sinn bedeutet Transfer die Arbeit an der Verdichtung dessen, was alles in und rund um das Kulturagentenprogramm passiert ist, und die Entscheidung, was davon in welcher Form und in welcher Absicht an Dritte in motivierender Weise herangetragen werden soll. Dies stellt keinen einseitigen Vorgang dar; vielmehr erfüllt sich jeder Transfer erst mit der aktiven Aneignung der vermittelten Botschaften durch die, an die sich der Transfer richtet. Dazu können sich Einladungen an neue Zielgruppen, sich mit den Erkenntnissen des Kulturagentenprogramms auseinanderzusetzen genauso eignen wie mittelbare, wenn es um eine projektspezifische Anreicherung des öffentlichen Fachdiskurses zum Stellenwert von Kunst in der Schule geht.
Implementieren – ein letzter Versuch
Das Wort Implementierung kommt vom Lateinischen "implere" und bedeutet "anfüllen" beziehungsweise "erfüllen". Dieser Bedeutung zufolge geht es beim Implementieren zuallererst darum, bereits bestehende Formen mit (neuen) Inhalten zu füllen. Überzeugt davon, dass es sich beim Kulturagentenprogramm auch und gerade um ein Sinnstiftungsprogramm handelt, käme die Verwendung des Begriffs der Implementierung die Bedeutung zu, nicht unbedingt neue Formen zu kreieren (und andere aufzufordern, dem eigenen Beispiel zu folgen), sondern bereits Bestehendes mit neuem Inhalt, mit Sinn zu füllen.
Es ist vor allem die technokratische Verwendung des Begriffs, der die Definition von Implementierung zur "Umsetzung von festgelegten Strukturen und Prozessabläufen in einem System unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, Regeln und Zielvorgaben"8 verengt hat. Der Logik repräsentativer Politikgestaltung folgend, suggeriert diese Interpretation noch einmal einen Machtanspruch in einem System, das vorgibt, sich zentral steuern zu lassen. "Es muss einen für alle verbindlichen Plan geben!", rufen deren Apologetinnen und Apologeten, auch wenn sie um sich herum täglich neu erfahren müssen, wie zentrale Steuerungsversuche schmählich versagen und selbst scheinbar sehr machtvolle Akteure ihr Einflussgebiet immer weniger "im Griff" haben.
Diese Erfahrungen berücksichtigend, könnte sich das Kulturagentenprogramm als ein Vorreiter einer alternativen, der Sache weit eher entsprechenden Implementierungsstrategie erweisen. Eine solche wäre nicht beherrscht von einer überkommenen Top-down-Haltung zur Durchsetzung von Oktrois, sondern von einem Anspruch des Bottom-up getragen, der alle Beteiligten beziehungsweise Beteiligungswilligen als Expertinnen und Experten ihrer spezifischen Lern- und Arbeitsbedingungen zu gleichberechtigten Akteuren erklärt.
Dies vorausgesetzt mutiert Implementierung von der Hoffnung auf Verordenbarkeit hin zur Notwendigkeit der Aushandlung auf Augenhöhe. Das ist mühsam und anstrengend, aber unumgänglich, vor allem wenn wir der Sache der Kunst gerecht werden wollen. Immerhin ist die Erfahrung der Kunst zuallererst eine individuelle; sie kann nicht durch die Erfahrung noch so vieler anderer ersetzt werden und bedarf des aktiven Engagements jeder/s Einzelnen, die oder der frei darüber entscheiden können muss, ob sie oder er sich daran beteiligen mag oder nicht.
Dass diese individuellen Erfahrungen immer in einem sozialen Umfeld stattfinden, ändert am Primat des Individuellen nichts. Erst die Zusammenschau vieler Einzelner schafft die Voraussetzungen dafür, dass sich überindividuelle Aussagen treffen lassen, die den öffentlichen Diskurs speisen. Ebenso aber wie Theoriebildung für sich ohne entsprechenden Praxisbezug ihren Sinn verliert (und umgekehrt), so wenig kann gerade im Bereich kultureller Bildung individuelles Engagement von sozialer Intervention (in unserem Fall der Implementierung des "Das") getrennt werden. Beide sind aufeinander angewiesen; sie bedingen einander.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen gutes Gelingen bei der Spezifikation Ihres "Das" samt den daraus ableitbaren Implementierungsüberlegungen, die Sie damit verbinden: Auf dass Sie auf dieser Grundlage zu einem guten gemeinsamen Ergebnis kommen.
Dieser Text entstand als Beitrag zur Akademie "Reflexion, Verstetigung, Transfer" des Programms "Kulturagenten für kreative Schulen" am 13. und 14. November 2014 in Hamburg.
1 http://www.kulturagenten-programm.de/programm/ziele/ [29.11.14].
2 Schwarzwald, Eugenie: Das Lied in der Schule, Jahresbericht 1909/1910
3 Holmes, Deborah: Langeweile ist Gift, Wien 2012.
4 http://educult.at/featured/foerderung-von-modellprojekten-kultureller-bildung/ [29.11.14].
5 Groys, Boris: Über das Neue, München, Wien 1992, S. 9.
6 http://www.kulturagenten-programm.de/programm/ziele/ [29.11.14].
7 Siehe als nur ein Beispiel: Transferkonzept für das BLK-Modellprogramm "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung", online: http://www.transfer-21.de/daten/texte/transferkonzeptlang.pdf [29.11.14].
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Implementierung [29.11.14].

