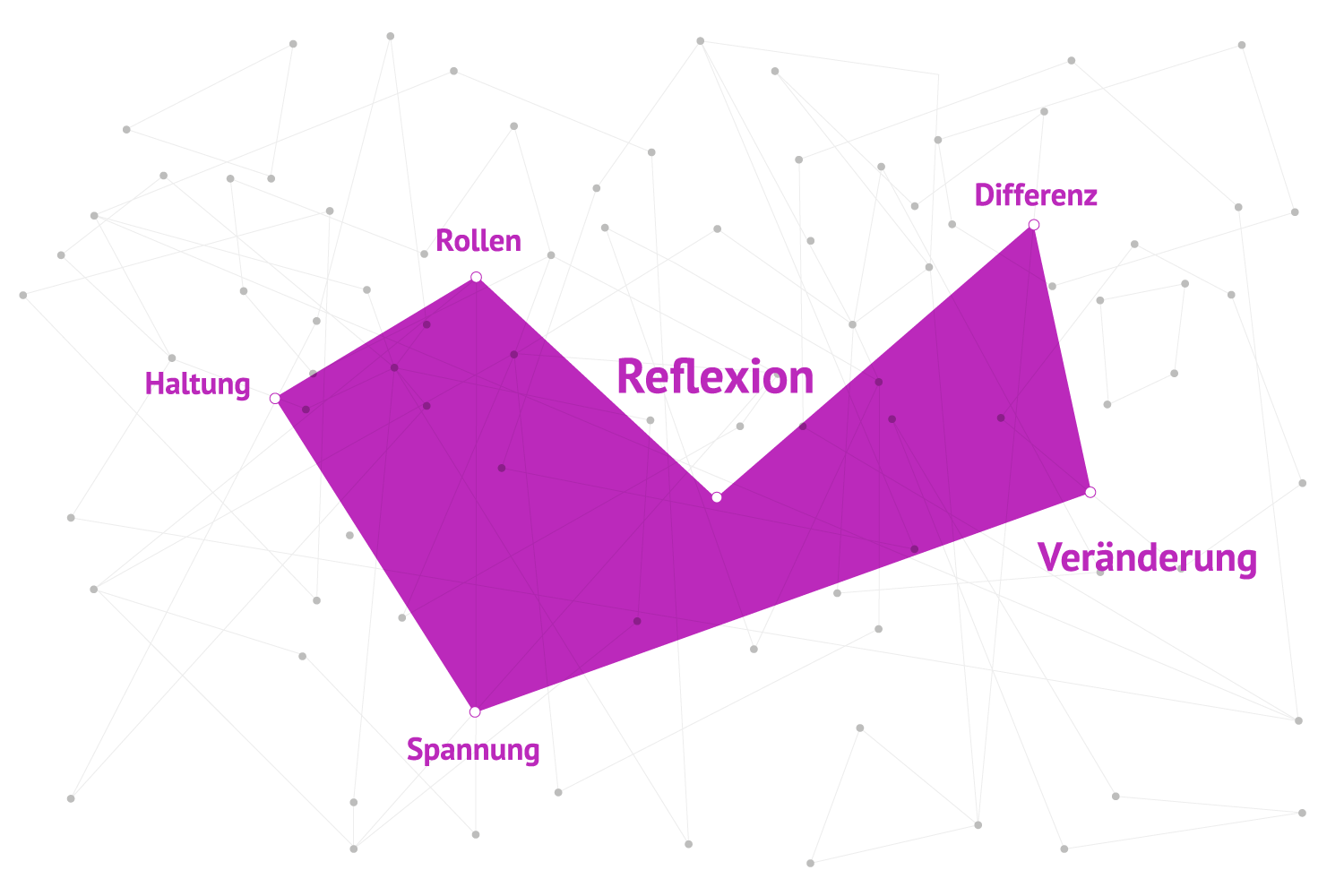
Praxisforschung als Perspektive für die Qualifizierung von KulturagentInnen
Ausgangslage: Von reflektierten PraktikerInnen und Praxisforschung
Von Mai 2014 bis Juli 2015 habe ich Constanze Eckert, die Leiterin der Qualifizierung von KulturagentInnen1 im Modellprogramm "Kulturagenten für kreative Schulen", und ihre inhaltliche Arbeit als kritische Freundin2 unterstützt. Von Beginn an verfolgte sie mit ihrem Konzept der Qualifizierung die Verschränkung von Theorie und Praxis mit dem Anliegen, die KulturagentInnen als "reflektierte PraktikerInnen" auszubilden. Dieser Anspruch war für alle Ebenen der Qualifizierung leitend: Ob in den Akademien durch die thematisch fokussierten Auseinandersetzungen mit dem State of the Art in Form von Inputs (inter-)nationaler AkteurInnen aus Theorie und Praxis der kulturellen Bildung, durch inhaltliche Impulse und Reflexionsrunden mit den KulturagentInnen bei Besuchen der Akademieleitung in den Länderbüros oder durch überregionale Reflexionstreffen. Hier vor allem durch intensive Textarbeit und die Konzipierung von Vermittlungsworkshops für die KollegInnen. Die Auseinandersetzung der KulturagentInnen mit verschiedenen Modellen und Konzeptionen von kultureller Bildung bot ihnen auf diese Weise immer wieder einen Anlass, das eigene Handeln in den Schulen im Kontext aktueller Diskurse zu befragen. So war die Akademie ein überregionaler Reflexions- und Denkraum zur KulturagentInnenpraxis, der immer im Verhältnis zum Feld der kulturellen Bildung außerhalb des Programms erfolgte. Praxisforschung als einen Qualifizierungsaspekt in das Kulturagentenprogramm hineinzutragen, war mit diesen, hier beschriebenen Anliegen eng verbunden.
Praxisforschung entwickelte sich in den 1960er Jahren in den Sozialwissenschaften als eine engagierte Forschung, die in die soziale Wirklichkeit, die sie untersucht eingreift und damit die Grenze zwischen Forschenden und Beforschten, zwischen Forschung und ihrem Gegenstand hinterfragt und verschiebt. Ansätze der Praxisforschung grenzen sich in der Weise von der Sozialforschung ab, als sie nicht von "außen" Wissen für oder über Praxis produzieren. Stattdessen setzen sie "auf Problemlösung und Transformation durch die Erforschung von im Arbeitsalltag entstehenden Fragen durch professionell Handelnde, allein oder im Team. Zentral für diese Ansätze ist die Aufwertung des Wissens von PraktikerInnen gegenüber außerhalb der konkreten Arbeit generiertem ‹ExpertInnenwissen›"3. Eine kritisch informierte Praxisforschung ist an einer Umverteilung von Deutungsmacht interessiert und stellt immer auch Fragen nach dem ExpertInnentum wie; "Wer spricht für wen? Wer spricht zu wem? Warum? Mit welchem Interesse und mit welcher Wirkung?". Damit führt sie eine Reflexion von den herrschenden und als natürlich wahrgenommenen Ordnungen und Regeln der Felder ein, in denen sie agiert und die sie untersucht. Dabei ist Praxis grundsätzlich maßgeblich an der Diskursproduktion beteiligt, so auch im Feld kulturelle Bildung. Allerdings nimmt sie hier zumeist eine legitimatorische Rolle ein, dienen Praxisbeispiele in der Regel dazu, kulturpolitische Agenden zu untermauern bzw. die Versprechen von kultureller Bildung zu veranschaulichen. So erzählen Praxisbeispiele im Sinne einer best Practice zumeist von den Erfolgen künstlerisch-edukativer Prozesse. Diese werden entlang bestehender Förderkriterien und Programmziele formuliert. Wie wir wissen, zeigt sich die Praxis aber oft von einer anderen, weniger in die Legitimationsmaschinerie passenden Seite – sie ist mitunter widerständig, kompliziert und lässt oft nur wenig Raum, um die hehren Ziele kulturpolitischer Anliegen zu verwirklichen. Insbesondere gilt dies für eine Praxis, die – wie es im Kulturagentenprogramm der Fall war –, so eng an die programmatischen Setzungen geknüpft ist. Eine solche Praxis agiert immer im Spannungsfeld von Programminteressen, Eigeninteressen und den zahlreichen Interessen der beteiligten AkteurInnen.
Insbesondere bei der kulturellen Bildung handelt es sich um ein Feld voller Spannungen und Zuschreibungen, dem, wie Agnieszka Czejkowska schreibt, "phantastische Möglichkeiten und Gestaltungsspielräume angedichtet werden"4. Insofern finden auch Forschung und Theoriebildung nie in einem wertfreien oder interesselosen Raum statt, und kann auch eine Praxisforschung keinen Ausweg aus der Ambivalenz zwischen dem Nachweis erwünschter Wirkungen und der Ergebnisoffenheit von Forschung bieten. Sie kann jedoch die Entfaltung von Reflexionsfähigkeit im Praxisfeld unterstützen, anwendbare Ergebnisse produzieren und so zu seiner Weiterentwicklung der Praxis der Akteure beitragen, ohne sich dabei in den Dienst institutioneller und kulturpolitischer Imperative stellen zu müssen – aber auch, ohne eine Unberührtheit von diesen zu behaupten. Praxisforschung birgt damit das Potenzial, die Spannungsverhältnisse in denen die Praxis agiert mit zu berücksichtigen, zu analysieren und sich ihnen immer wieder gewahrzuwerden.
Bereits zum Auftakt der Qualifizierung in der ersten Akademie wurde der Praxisforschungsansatz im Rahmen einer Tischwerkstatt (Input) als mögliche Methode für die Gestaltung der KulturagentInnentätigkeit eingeführt. Eine konsequente, für alle KulturagentInnen verpflichtende Implementierung von Praxisforschung als fortlaufende Qualifizierungsmaßnahme war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht möglich. Zu viele Variablen waren im Kulturagentenprogramm noch undefiniert, um die für die Praxisforschung benötigten Zeiträume einzuplanen und die notwendigen Ressourcen auf Landesebene und überregional zur Verfügung zu stellen. So ergab sich erst im letzten Programmjahr die Möglichkeit, die Durchführung eines Praxisforschungsprojekts als Qualifizierungselement verbindlich für alle KulturagentInnen einzuführen. JedeR KulturagentIn sollte ein eigenes Forschungsvorhaben entwickeln, umsetzen und dabei möglichst einen gesamten Aktionsforschungszyklus durchlaufen: von der Analyse über die Aktion zur Reflexion und wieder zur Analyse. Zu meinen Aufgaben zählte die methodische Unterstützung sowohl bei der Entwicklung der Forschungsfrage und der Wahl des methodischen Zugangs als auch später bei der Auswertung.
Aufgrund der enormen Arbeitsbelastung der KulturagentInnen sollte das Forschungsvorhaben nicht als zusätzliches Projekt begriffen, sondern als Möglichkeit genutzt werden, bestehende Fragen des Arbeitsalltags systematisch zu reflektieren und zu analysieren. Entsprechend offen war die Projektanlage konzipiert. Die Forschungen konnten allein, zu zweit, mit AkteurInnen aus der Schule oder in Zusammenarbeit mit anderen KooperationspartnerInnen umgesetzt werden. Auch in ihrem Umfang konnten sie variieren. Mikrountersuchungen, wie die Rekonstruktion einer Vorgehensweise hinsichtlich einer bestimmten Fragestellung bis hin zu partizipativen Ansätzen, in denen SchülerInnen oder LehrerInnen in die Forschung verwickelt werden, waren möglich. Fokus und Ausgangspunkt sollte der KulturagentInnenalltag sein.
"Eigene Erfahrungen als Erfahrungen wahrzunehmen und durch einen Reflexionsprozess aus ihnen Erkenntnisse zu erarbeiten, stärkt das Vertrauen in den eigenen Erfahrungshintergrund und schafft notwendige Standflächen für Anerkennung und Umgestaltung."5
Herausforderung Praxisforschung
Das, was zunächst einfach und sehr nah an dem schien, was die KulturagentInnen sowieso täglich tun, nämlich handeln, reflektieren und ihre Handlungen auf der Grundlage dieser Reflexionen anpassen, zeigte sich in der konkreten Umsetzung als herausfordernd. Schon die Entwicklung einer Forschungsfrage, die methodisch umsetzbar und damit beantwortbar wäre, erwies sich für viele als anspruchsvolle Aufgabe. Das hatte nicht zuletzt auch mit den unterschiedlichen Vorstellungen von Forschung und damit einhergehenden Ansprüchen an die eigene Forschungsarbeit zu tun: Dabei wurden mindestens zwei ambivalente Perspektiven wirksam: Während die einen sich selbst nicht zutrauten, zu forschen – und die als "Forschung" deklarierte Handlung als Überforderung erlebten –, begegneten andere auch unter Bezugnahme auf eigene Forschungserfahrungen dem Praxisforschungszugang selbst mit Skepsis. In beiden Fällen wurde die Wissenschaftlichkeit der Forschungsanlage in Frage gestellt.
Mit ähnlichen Phänomenen hat Praxisforschung in pädagogischen Settings seit ihren Anfängen immer wieder zu kämpfen. Auch die verbreitete Abwehrhaltung gegen Forschung und damit die Bestätigung des sogenannten Praxis-Theorie-Gaps zeigte sich. Einige KulturagentInnen begriffen sich nicht als "WissenschaftlerInnen" und konnten den Nutzen der Praxisforschung für sich nicht erkennen. Praxisforschung bedeutet aber tatsächlich immer auch Verunsicherung; und es gibt keine Methodenbaukästen, auf die sich zurückgreifen ließe. So spiegelte sich auch in der Projektanlage die marginalisierte Position der Praxisforschung im akademischen Feld wider, die um Legitimation kämpfen muss, da sie als recht junge Disziplin die Deutungshoheiten etablierter Herangehensweisen befragt und erweitert. Die erhöhte Arbeitsbelastung des letzten Programmjahrs hat die vorhandene Skepsis und Verunsicherung sicherlich noch begünstigt, sodass jene AgentInnen, die Vorbehalte hatten, auch mit Abwehr auf die Aufgabenstellung reagierten. Trotz allem haben fast alle KulturagentInnen ein Forschungsprojekt umgesetzt.
Die Praxisforschungen der KulturagentInnen
Die Forschungszugänge der KulturagentInnen waren individuell und zeichneten sich durch ein breites methodisches Spektrum aus. Ein Agent beispielsweise untersuchte, in welcher Weise sich seine Arbeit anhand der In- und Outboxes seiner Mailaccounts abbilden ließe. Dafür clusterte er rund 3.000 E-Mails der letzten drei Jahre unter bestimmten Kriterien: An wen wurden wie viele E-Mails versendet? Welche Begriffe wurden am häufigsten verwendet? Was wurde in die Betreffzeile geschrieben? Es war der Versuch, einerseits die versteckte, wenig thematisierte und dennoch enorme Kommunikationsleistung eines Kulturagenten sichtbar zu machen und andererseits zu untersuchen, was sich anhand dieses Kommunikationskonzentrates zeigt. Mit einer ähnlichen Frage befasste sich das Vorhaben einer Kulturagentin, das das Spektrum ihrer Tätigkeiten anhand eines Fotos pro Woche visuell sichtbar machen wollte. Die Dokumentation alltäglicher Handlungen sollte einen neuen Blick auf wiederkehrende Arbeiten ermöglichen. Beide methodischen Zugänge zeichneten sich dadurch aus, dass sie eine Distanzierung zum täglichen Handeln ermöglichten und damit eine differenzierte Betrachtung eigener Herangehensweisen erleichterten.
Mehrere Praxisforschungen befassten sich mit der Frage "Was bleibt?". Sie versuchten auf unterschiedliche Weise – über Interviews, persönliche Plädoyers oder automatisches Schreiben – die individuellen Perspektiven der am Programm beteiligten SchülerInnen, Lehrenden und Kulturbeauftragten einzufangen. Hier wurde der Ansatz der Praxisforschung dafür genutzt, um methodische Zugänge zu entwickeln, die künstlerische mit sozialwissenschaftliche Ansätzen verbanden. Beim automatischen Schreiben beispielsweise entstanden sehr persönliche Texte einzelner ProgrammakteurInnen, die anonymisiert und für eine weitere Reflexion genutzt wurden. Die Kulturagentin, die diese Methode anwendete, legte die verschiedenen Texte nebeneinander, markierte einzelne Begriffe farbig und zählte diese. Diese grafische Bearbeitung der Texte setzte sie dann in unterschiedlichen Zusammensetzungen von Personengruppen fort, nutzte dies einerseits für die Analyse der Texte und andererseits als Anlass für eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen und Interpretationen dieser Texte.
Zwei Kulturagentinnen haben sich für ein dialogisches Forschungsprojekt zusammengeschlossen und untersuchten die Zusammenarbeit zwischen Museum und Schule aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln: Während die eine die Frage "Was ist ein Museum?" gemeinsam mit SchülerInnen behandelte, entwickelte die andere analog zum Kulturfahrplan der Schulen einen Bildungsfahrplan mit einem Museum. Sie initiierte hierfür eine Befragungssituation für eine intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Museen zu Status und Umgang mit Vermittlung. Auch hier wurde das Projekt nutzbar gemacht, um einen systematischen Dialog zwischen den Institutionen Schule und Museum einzuleiten. Insbesondere der Austausch zwischen den Kulturagentinnen selbst eröffnete die Möglichkeit einer kollegialen Beratung, die in beiden Fällen eine Weiterentwicklung der eigenen Arbeit unterstützte.
So unterschiedlich sich die einzelnen Vorhaben entfalteten, so waren sie doch von einem spezifischen gemeinsamen Interesse geprägt: nämlich die Routinen, Setzungen und Annahmen – also das Selbstverständlich gewordene ihrer Arbeit – noch einmal genauer in den Blick zu nehmen. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Prämissen ist für eine reflexive Praxis wesentlich. Aus der Perspektive der Qualifizierung von KulturagentInnen erfüllte sie gleich mehrere Funktionen: Sie ermöglichte den AgentInnen eine für sie bedeutsame Frage noch einmal resümierend und systematisch zu untersuchen. Und sie unterstützte dadurch die Identifizierung spezifischer und für den Diskurs der kulturellen Bildung relevanter Aspekte. So ging es auch darum, das Sprechen über die eigene Praxis hinsichtlich der Ergebnissicherung zum Programmabschluss zu unterstützen. Nicht zuletzt zeigte sich dies in der großen Beteiligung der KulturagentInnen an der Textproduktion für die Abschlusspublikation des Kulturagentenprogramms. So haben beispielsweise allein in Modul 3 "Reflexion – Zwischen Theorie und Praxis" 23 KulturagentInnen Beiträge (Texte und Zeichnungen) erarbeitet, die ihre eigene Praxis mit Texten von AutorInnen aus dem Feld ins Verhältnis setzen.
Unter erschwerten Bedingungen
Praxisforschung ist inhaltlich herausfordernd. Nicht nur, weil die PraxisforscherInnen selbst in die Verhältnisse, die sie betrachten verstrickt sind und somit Forschende und Handelnde zugleich sind, sondern auch weil sie in der Regel viel Zeit erfordert. Zeit, die meistens nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung steht – Praxisforschung scheint nie zu passen, geschieht immer nebenbei, muss sich Räume erkämpfen. Dies war auch in der Anlage der Qualifizierung im Kulturagentenprogramm nicht anders. Der Baustein "Praxisforschung" stellte nur eine von vielen Anforderungen an die KulturagentInnen dar und wurde entsprechend unterschiedlich priorisiert. Neben notwendigen Zeitfenstern ist das eigene Forschungsinteresse eine weitere zentrale Bedingung von Praxisforschung. Dieses kann eventuell angeregt, aber nicht von außen auferlegt werden. Die Tatsachen, dass Praxisforschung als Pflichtaufgabe im Rahmen der Qualifizierung gesetzt wurde, und die KulturagentInnen in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zur Auftraggeberin standen, standen somit in einem grundlegenden Widerspruch zu den Bedingungen von Praxisforschung selbst. Dies führte dazu, dass einige KulturagentInnen den Auftrag zwar umsetzten, allerdings ohne ihn zu einem persönlichen Anliegen zu machen. Hinzu kam die fehlende Übung in Praxisforschung. Nur die wenigsten KulturagentInnen verfügten über Forschungserfahrungen, die sie für die Entwicklung ihrer Forschungsanlage nutzen konnten. Sie brauchten Unterstützung in der Entwicklung einer Forschungsfrage, der Erarbeitung eines Forschungsdesigns sowie in der Umsetzung und Auswertung. Zwar stand ich zur Unterstützung zur Verfügung, doch konnte diese bei 46 KulturagentInnen nur punktuell erfolgen. Gleichzeitig griffen trotz vieler methodischer Unsicherheiten nur die wenigsten KulturagentInnen auf angebotene Beratung zurück. Am fruchtbarsten waren die bilateralen Beratungseinheiten, die ich während der Akademien vor Ort mit einigen KulturagentInnen hatte. Die hier geführten Gespräche waren sehr produktiv, und das Interesse an der Forschung wurde in diesen Momenten spürbar. Doch zurück im Alltag verschoben sich die Prioritäten, und die Praxisforschung geriet in der Regel wieder ins Hintertreffen. Das war zeitweise für alle Seiten frustrierend, weil sich das spürbar gewordene Potenzial unter den herrschenden Rahmenbedingungen nur bedingt entfalten konnte. Wir – Constanze Eckert und ich – hätten die KulturagentInnen gerne häufiger zu regelmäßigen Austauschtreffen eingeladen, methodische Inputs organisiert und eine bilaterale Unterstützung vor Ort zur Verfügung gestellt, was der ambitionierte Alltag von KulturagentInnen nicht erlaubte.
Dies zeigte sich vor allem in der Auswertungsphase. Denn während viele KulturagentInnen individuelle Methoden der Erhebung entwickelten und reichhaltiges Datenmaterial sammelten, erwies sich das Auswerten und Analysieren des Materials als besonders herausfordernd. Die Klassifizierung in Kategorien und das Lesen von Daten über die Aussageebene hinaus hätten eine engmaschige methodische Unterstützung erfordert, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die über das bereits Gewußte hinausweisen können. Dies hätte aber als Anspruch von allen Ebenen des Programms mitgetragen werden und in entsprechende Strukturen vor Ort übersetzt werden müssen. Die Analyse von Daten erfordert viel Zeit, und muss, wie andere Praktiken auch, geübt werden. Hierfür wäre eine fortlaufende methodische Unterstützung der KulturagentInnen vor Ort sicherlich sehr nützlich gewesen (siehe hierzu ausführlicher die Empfehlungen am Ende des Textes).
Fazit: Praxisforschung für alle?
Für mich als Begleiterin des Forschungssetting und der Qualifizierung selbst stellten sich nach dem Abschluss des Programms viele Fragen: Welche Voraussetzungen hätte es gebraucht, um Praxisforschung in der erhofften Weise nutzbar zu machen und das Wissen sowie die Expertise der KulturagentInnen, die bislang im deutschsprachigen Raum einzigartig sind, für den Diskurs im Feld der kulturellen Bildung noch produktiver zu machen? In Momenten des Zweifelns fragte ich mich, ob es nicht besser gewesen wäre, gänzlich auf den Ansatz einer Praxisforschung für alle zu verzichten und statt dessen lediglich jene KulturagentInnen mit einem Projekt zu begleiten, die ein Interesse an der Praxisforschung zeigten. Doch wäre dies ein Ausweg aus den widersprüchlichen Interessen gewesen? Das Anliegen von Constanze Eckert war es, die KulturagentInnen mit den Ansätzen, Methoden und Potenzialen von Praxisforschung vertraut zu machen. Aus Qualifizierungsperspektive konnte dies nicht nur für einige Wenige gelten, sondern alle sollten einen Einblick in ein Vorgehen erhalten, welches maßgeblich zur Entwicklung einer reflexiven Praxis beitragen kann. Und so bedeutete auch die Projektanlage selbst ein Agieren in Spannungsverhältnissen.6 Meine Sorge war es trotzdem, dass das gewählte Vorgehen mitunter das Anliegen von Praxisforschung nicht adäquat vermitteln und sogar Gefahr laufen würde, durch die Verpflichtung zur Forschung, den späten Zeitpunkt im Programmverlauf und die lediglich punktuell erfolgte methodische Unterstützung das Gegenteil zu bewirken. Nämlich Praxisforschung als nicht ernstzunehmende Praxis zu disqualifizieren. Sicher, die Bedingungen waren nicht die besten, aber was Agnieszka Czejkowska im Zusammenhang mit Drittmittelforschung schon treffend bemerkt: " […] ob es uns gefällt oder nicht, die Spielräume sind winzig, die wenigen vorhandenen gilt es zu nutzen und auszuweiten, nicht zu verpassen"7. Dies gilt auch für die Praxisforschung.
Das Experiment der Praxisforschungen der KulturagentInnen erfolgte in einem geschützten Rahmen – nämlich in einer Qualifizierung und war ein Lernarrangement. Folglich sollte es nie der Anspruch sein, sich damit im akademischen Feld zu behaupten. Jene Momente, in denen KulturagentInnen durch das Forschungsprojekt ihr eigenes Handeln in einem neuen Blickwinkel sahen oder alternative Handlungsoptionen entdeckten, sind es, die keinen Zweifel daran lassen, dass es sich gelohnt hat, auch mit kleinen Schritten voranzuschreiten. Praxisforschung ist dann die Möglichkeit, sich selbst auf die Schliche zu kommen.
Und so lassen sich am Ende folgende Erkenntnisse für zukünftige Anlagen von Praxisforschungsvorhaben im Rahmen größerer Projektanlagen ableiten:
- Praxisforschung sollte von Beginn an strukturell eingeplant werden.
- Praxisforschung benötigt Zeit.
- Praxisforschung braucht methodisches Werkzeug, welches auf bestehende Ansätze der qualitativen Sozialforschung zurückgreift, diese modifiziert und aneignet, aber auch neue Ansätze erprobt. Dieser Weg erfordert Mut und größtmögliche Sorgfalt. Weniger ist in dem Fall mehr. Die Konzentration auf eine Frage ist herausfordernd und braucht in den meisten Fällen, vor allem bei AkteurInnen mit wenig Forschungserfahrung, methodische Begleitung. Ein Austausch über das methodische Vorgehen im Team oder bilateral muss eingeplant werden, um die Potenziale der Praxisforschung wirklich produktiv zu machen.
- Praxisforschung muss geübt werden. Wie alle Praktiken, muss auch oder gerade die analytische Umgangsweise mit der eigenen Praxis eingeübt werden. Die Projekte der KulturagentInnen in der Qualifizierung waren entsprechend nur ein erster Schritt in diese Richtung.
1 Ich habe meine üblich verwendete genderbewusste Schreibweise mit dem Unterstrich (Kulturagent_innen), die sich gegen die binäre, auf männlich und weiblich festgelegte Ordnung der Geschlechter richtet, an die redaktionellen Vorgaben der Publikation (Binnen-I) angepasst.
2"Eine kritische Freundin ist eine Person des Vertrauens, die provokative Fragen stellt, Daten in einem anderen Blickwinkel darstellt und als Kritik an der Arbeit vor Ort übt. Eine kritische Freundin nimmt sich Zeit, um den Kontext der betreffenden Arbeit und die Ziele […] zu verstehen. Die kritische Freundin ist eine Advokatin für den Erfolg dieser Arbeit." Vgl. Costa, Arthur L. & Kallick, Bena: Through the Lens of a Critical Friend, In: New Roles, New Relationships, October 1993, Volume 51, Number 2, S. 49 - 51
3 Landkammer, Nora: Vermittlung als kollaborative Wissensproduktion und Modelle der Aktionsforschung. In: Bernadett Settele, Carmen Mörsch et al. (Hg.): Kunstvermittlung in Transformation, Zürich: Scheidegger&Spiess, 2012, S. 200
4 Czejkowska, Agnieszka: "Ob es uns gefällt oder nicht. Kulturelle Bildung und drittmittelbasierte Forschung", in: Mörsch, Carmen (Hg.): Art Education Research Nr. 4, Jg. 3. gem. mit Marianne Sorge (Illustriationen), Zürich 2011, S. 5
5 Muhr, Mikki: SICH VERZEICHNEN – mit Karten sich im Zwischenraum orientieren. Eine künstlerische Methode für reflexive Bildungsprozesse. In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs. Ausgabe 15, 2012. Wien, S. 2 www.erwachsenenbildung.at/magazin/12-15/meb12-15.pdf [14.01.2016]
6 Vgl. Carmen Mörsch 2013 in der Onlinepublikation: Zeit für Vermittlung: www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/index.html [19.1.2016].
7 Czejkowska, A., a.a.O, S. 5

